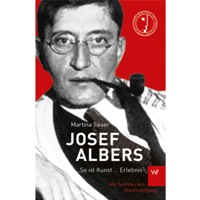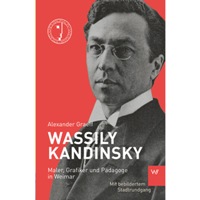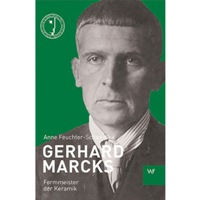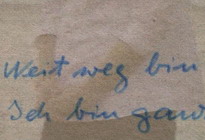| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Elke Beilfuß Designgeschichten Johann-Sebastian-Bach-Str. 6 99423 Weimar Telefon 0049-3643-2112457 Email
schreiben
|
|
|
|
| |
|
|
| |
Publikationen & Herausgeberschaft
Bauhaus Personenreihe
hrsg. von Elke Beilfuß, Verlagshaus Römerweg, Wiesbaden und Weimar seit 2015. Als freiberufliche Kulturwissenschaftlerin gibt Elke Beilfuß eine mehrbändige Buchreihe zum Thema Bauhaus heraus. Vorgestellt werden Künstlerpersönlichkeiten, die am historischen Bauhaus in Weimar in den 1920er Jahren gelehrt oder studiert haben, darunter zwei Frauen: Gunta Stölzl und Marianne Brandt.
2018
Anne-Kathrin Weise: Marianne Brandt. Wegbereiterin des Produktdesigns
hrsg. von Elke Beilfuß, Wiesbaden 2018
2017
Gudrun Wessing: László Moholy-Nagy. Gestalter des bewegten Lichts
hrsg. von Elke Beilfuß, Wiesbaden 2017
Ingrid Radewaldt: Gunta Stölzl. Pionierin der Bauhausweberei
hrsg. von Elke Beilfuß, Wiesbaden 2017
Martina Sauer: Josef Albers. Nur der Schein trügt nicht
hrsg. von Elke Beilfuß, Wiesbaden 2017
Alexander Graeff: Wassily Kandinsky. Maler, Grafiker und Pädagoge in Weimar
hrsg. von Elke Beilfuß, Wiesbaden 2017
Anne Feuchter-Schawelka: Gerhard Marcks. Formmeister der Keramik
hrsg. von Elke Beilfuß, Wiesbaden 2017
Elke Beilfuß: Oskar Schlemmer. Meister der tanzenden Form
hrsg. von Elke Beilfuß, Wiesbaden 2017
2016
Karin Thönnissen: Johannes Itten. Leben in Form und Farbe
mit einem Vorwort von Elke Beilfuß (Hg.), Weimar, Wiesbaden 2016
2015
Karen Michels: Paul Klee. Der "liebe Gott" am Bauhaus
mit einem Vorwort von Elke Beilfuß (Hg.), Weimar, Wiesbaden 2015
2014
Oskar Schlemmer. Texte, Briefe, Schriften
aus der Zeit am Bauhaus
Ausgewählt und kommentiert von Elke Beilfuß (Hg.), Weimar 2014
Kunststoff als Design-Material
Wohnkultur im Stil der 1968er
116 Seiten, Paperback ISBN: 978-3-95850-668-8, Hamburg 2014 (zugl. Magisterarbeit an der Universität Bremen 2002)
2013
Zur Sammlung des Archiv der Moderne
Texte für das Archiv an der Bauhaus-Universität Weimar
www.uni-weimar.de/Archiv der Moderne
2012
Bauhaus-Museum für Weimar
in: db deutsche bauzeitung, 09 · 2012, S. 7
Architekturvermittlung als Partizipation und Inspiration
Konferenzbericht zum 4. Internationalen Symposium Architektur-
vermittlung
»Stadtgespräche«, 27. - 28. April 2012 in Weimar
am 5.6.2012 auf www.kulturmanagement.net
Trautes Heim. Wohnen mit Textilien
in: Auf Tuchfühlung. 700 Jahre textile Vielfalt am Niederrhein,
Kat.-Ausst. Städtisches Museum Wesel, hrsg. von Jürgen Becks
und Karin Thönnissen, dt. u. nl., Wesel 2012, S. 183-208
2010
Ergonomie im Dienst der Arbeitskraft
in: Regjo, Heft 03 · 2010, S. 37
2009
Texte für Imageclips - Thüringer Innovationspreis 2009
Nominierungsclips von Stefan Kraus (Regie) und Marc Sauter (Ton), hrsg. von Gregor Sauer, Bauhaus.TransferzentrumDESIGN, Weimar 2009. Im Auftrag der Stiftung zur Förderung innovativer Technologien in Thüringen - STIFT
auf: YouTube - Bauhausmaschine - Kanal von Bauhausmaschine
Im Zeitalter computertechnischer Reproduzierbarkeit
in: Sauter & Kraus: BAUHAUSMASCHINE, hrsg. vom Bauhaus.TransferzentrumDESIGN, Weimar 2009, S. 10-19
bauhaus feminin - ein Mythos
in: Kulturjournal Mittelthüringen, April 2009
Auf Distanz zum Gewöhnlichen
gemeinsam mit Martina Sauer,
in: Design Report, 01 · 2009
2008
Tagungsbericht: Ästhetik und Alltagserfahrung
VII. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik,
gemeinsam mit Martina Sauer,
in: h-soz-kult, Tagungsberichte, veröffentlicht am 18.11.2008
2007
Kunststoff - Material der Stunde?!
Möbeldesign und Wohngestaltung mit Kunststoffen um 1968
(zugl. Magisterarbeit an der Universität Bremen 2002),
Nachdruck, München GRIN Verlag 2007
2005
Inszenierung in der Inszenierung
Eindrücke in der Installation >Public FreedomMAK Wien 2005
2004
Horst Michel (1904 - 1989)
und das Institut für Innengestaltung.
Ein Ausstellungsprojekt der Bauhaus-Universität Weimar,
bogen, Universitätsjournal, Heft 3, 2004, S. 17
Horst Michel. Formgestalter in Weimar. Die Ausstellung
hrsg. von Siegfried Gronert und Elke Beilfuß, Weimar 2004
2003
Norbert Tadeusz. Italien sichten
Beitrag im Katalog zur Ausstellung,
hrsg. von der Stiftung Weimarer Klassik, Weimar 2003
2001
mach dir ein bild von annette hollywood
Beitrag im Ausstellungskatalog,
hrsg. von der halle für kunst, Lüneburg 2001
2000
Über die Minne im Tristan Gottfrieds von Straßburg
und das Verständnis von Liebe und Ehe in der Gesellschaft
um 1200,
Germanistik - Mediävistik, Hausarbeit, München GRIN Verlag 2000
1999
Bedeutung und Beachtung der Reliquien
im christlichen Abendland vom 11. bis 13. Jahrhundert,
Fach Kunst, Hausarbeit, München GRIN Verlag 1999 |
|



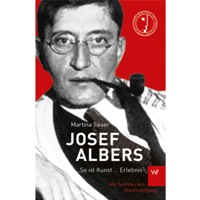
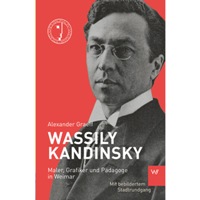
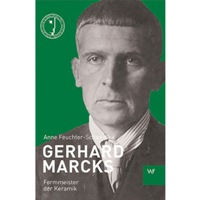




 |
|
| |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
| |
Im Zeitalter
computertechnischer Reproduzierbarkeit
von Elke Beilfuß
Der neuzigste Bauhausgeburtstag am 1. April 2009 wurde unter anderem auch im historischen Hauptgebäude der Bauhaus Universität Weimar ausgelassen gefeiert. Farbige Bildprojektionen mischten sich an den Wänden, ein weit ausladendes Mischpult nahm das Foyer ein, der Raum war mit Klang erfüllt und recht versteckt waren auch Stefan Kraus und Marc Sauter dabei, die das Szenario aufführten und an den Knöpfen ihrer Bauhausmaschine regelten. Besucher konnten sich förmlich in die Maschine »einschreiben«: Es gab ein Wacom-Zeichentablett, um Zeichnungen, Wörter oder Sätze einzufügen. So war zwar bei den späteren Aufführungen im Laufe des Bauhausjahres das digitale Zeichentablett nicht mehr dabei, doch jedes Mal ging das historische Bildmaterial aus der Weimarer und Dessauer Zeit des Bauhaus mit neuen und aktuellen Fotos vom heutigen Leben und Arbeiten im Milieu der Bauhaus Universität Weimar eine fortwährend neue Beziehung ein. Jede Aufführung ist also speziell auf den Ort, den Anlass und die Architektur und nicht zu letzt das Publikum abgestimmt und entsteht vor allem in und mit der Performance des VisualJockey, denn er regelt die Bauhausmaschine in jedem Moment.
Die Bauhausmaschine bietet folglich ein Experimentierfeld und knüpft somit an das Vorbild Bauhaus an. Eine Beziehung zur Experimentierfreude am Bauhaus lässt sich speziell zu Licht- und Klang-Installationen und zur mechanischen Bauhausbühne als einem Theater der Klänge herstellen. Erinnert sei exemplarisch an die von Ludwig Hirschfeld-Mack entwickelten Lichtspiele und Apparate sowie an Inszenierungen für die Bauhausbühne, wie »Das mechanische Ballett« von Kurt Schmidt (1923) oder »Die mechanische Exzentrik« von Laszlo Moholy-Nagy (1924).
Die Bauhausmaschine reproduziert und kombiniert das inskribierte Bildmaterial und stellt es aus. So liegt es nahe, im Folgenden über Walter Benjamins Ansatz zur Kunst im Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit nachzudenken. Benjamin unterscheidet hier freischwebende Kontemplation und politische Bedeutung von Kunstwerken sowie deren Rezeption, entweder mit der Betonung des Kultwertes oder des Ausstellungswertes. Weil die Bauhausmaschine zugleich als Aufführung (Inszenierung) sowie als Ausstellung (Präsentation) funktioniert, stellt sich die Frage nach der Rezeption. Der Flaneur, wie man ihn im 19. Jahrhundert und auch noch zu Beginn der Moderne antraf, soll daher als Vergleich dienen und uns mit seinen Sehgewohnheiten unserer Sehnsucht nach Müßiggang konfrontieren.
Die technische Reproduzierbarkeit
Die menschliche Sinneswahrnehmung hat sich im Laufe der Geschichte immer auch entsprechend der jeweiligen gesellschaftlichen Umwälzungen gewandelt oder anders gesagt, in einer neuen Wahrnehmung kommt gesellschaftliche Veränderung zum Ausdruck. Diese Ansicht vertrat insbesondere Walter Benjamin. Er widmete sich dem Thema 1935/36 in seinem im Pariser Exil entstandenen Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«. Ihn interessierte hierbei insbesondere die Wirkung massenmedialer Reproduktionstechniken in Bezug auf Kunst - sei es der Buchdruck, die Lithografie, die Fotografie oder der Film - in der jeweiligen Zeit ihrer Erfindung. Denn infolge der technischen Reproduzierbarkeit von Kunst, anders als bei manueller Kopie, geht nach Benjamin ihre Echtheit und somit ihre Autorität verloren. Indem er meint, in der Echtheit einer Sache vermittle sich alles Tradierte an ihr, von ihrer materiellen Dauer bis zu ihrer geschichtlichen Zeugenschaft, was zusammengenommen letztlich ihre Autorität ausmacht. All das fasst Benjamin im Begriff der Aura und schlussfolgert: »was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmert, das ist seine Aura.« (1)
Walter Benjamin erkennt eine veränderte soziale Funktion von Kunst. Ausgehend vom Ritual, sieht Benjamin das künstlerische Schaffen seit der Menschheitsgeschichte als originär in kultische Handlungen eingebettet. Im Verlauf der Geschichte und vor allem seit, wie Benjamin meint: »der Maßstab der Echtheit an der Kunstproduktion versagt« (2) orientiert sich die soziale Funktion von Kunst in eine politische Richtung. Hiermit verbunden ist auch die Unterscheidung Benjamins in Kultwert und Ausstellungswert des Kunstwerks, wobei er davon ausgeht, das ein kultisches Objekt, entweder nur Eingeweihten präsentiert wird und ansonsten aber verborgen bleibt, wo hingegen das technisch reproduzierte Kunstwerk, und hier weist er insbesondere auf Fotografie und Film hin, in jeder möglichen Form veröffentlicht wird. Benjamin schlussfolgert, somit habe sich die Rezeption von Kunst vom verborgen Kultischen hin zum öffentlichen Ausstellen gewandelt.
Dementsprechend attestiert Benjamin folgerichtig den Fotografien von Eugène Atget aus der frühen Zeit der Fotografie, als historische Beweisstücke, eine »verborgene politische Bedeutung« (3), spricht ihnen jedoch eine mögliche »freischwebende Kontemplation« (4) völlig ab. Desgleichen gilt gemäß Benjamin auch für den Film, der dem Vergleich mit dem Gemälde diesbezüglich nicht standhält: »Man vergleiche die Leinwand, auf der der Film abrollt, mit der Leinwand, auf der sich das Gemälde befindet. Das letztere lädt den Betrachter zur Kontemplation ein; vor ihm kann er sich seinem Assoziationsablauf überlassen. Vor der Filmaufnahme kann er das nicht.« (5)
Die Bauhausmaschine
Zumal die Bauhausmaschine von Stefan Kraus und Marc Sauter eine Maschine ist, die laufend mit Bildmaterial insbesondere von Kunst oder Kunstschaffensprozessen gefüttert wird, wäre gemäß Walter Benjamin gerade sie prädestiniert dafür, den Bildern ihre Aura zu nehmen. Doch mit welcher Art von Maschine haben wir es hier zu tun? Die Bauhausmaschine ist eine Maschine, die das gefütterte Bildmaterial nicht nur einfach reproduktiv wieder ausspuckt wie ein Filmapparat. Auch den Bedingtheiten des Films unterliegen die Projektionen der Bauhausmaschine nicht, denn es existiert weder Drehbuch, Schnitt, noch exakte Wiederholbarkeit. Die Bauhausmaschine verarbeitet die Bilder vielmehr zu etwas Neuem und Eigenem. Es entsteht eine assoziative Bilderfolge.
Die thematische Auswahl der Bilder, die in diesem Fall alle etwas mit dem Bauhaus - sei es mit dem historischen von 1919 oder dem zeitgenössischen seit den 1990er Jahren - zu tun haben, ergibt einen Mix, bei dem allerdings das Grundthema »Bauhaus« lesbar bleibt. Somit ist eines klar: Es gibt eine gewisse persönliche Auswahl - und zwar die von Stefan Kraus und Mark Sauter - mit welchen Inhalten die Maschine versorgt wird. Wenn sie es also auf die Spitze treiben würden, dann könnte das Grundthema hingegen der Flut der Bilder auch untergehen, was jedoch nicht beabsichtigt ist - das Prinzip »Verrätselung« wäre passender. Genau hierin ist auch das Konzept von Stefan Kraus und Marc Sauter begründet. Bereits die Phase der Planung, Konstruktion und Gestaltung von Hard- und Software der Bauhausmaschine zielt auf die Verrätselung der Bilder ab.
Reizvoll ist überdies die Interaktion zwischen Gestalter, Maschine und Betrachter. Zwischen Gestalter und Betrachter ist hier quasi die Maschine geschaltet. Sie - die Bauhausmaschine - verarbeitet das eingegebene Bildmaterial automatisch. Unterdessen greifen die Gestalter jedoch kreativ steuernd in den Fluss der Bilder ein und mischen kräftig mit. Ein ausgeklügeltes Computerprogramm gibt zwar zahlreiche Parameter vor - so interagiert der Bildwechsel mit den von Marc Sauter komponierten Musikstücken und Klangfragmenten - die Kombination, Wiederholung und Überschneidung der Bilder wird jedoch aktiv vom VJ gesteuert. So versteht sich Stefan Kraus als ein VisualJockey, der seine Maschine reitet wie der Jockey das Rennpferd.
Der Flaneur
Über die Flanerie zu Beginn der Moderne und die damit verbundene Zeit- und Raumwahrnehmung sprach Sylvia Stöbe ausführlich in ihrem Vortrag »Der Flaneur und die Architektur der Großstadt«. (6) Den flanierenden Dandy charakterisiert sie als eine Schwellenfigur zwischen Adel und Bürgertum. Zu Beginn des 19. Jahrhundert war die Flanerie noch Adligen, vornehmlich Männern, vorbehalten. Doch bereits um 1850 entstand ein neuer Typus des Flaneurs: der Schriftsteller, der Maler, der Journalist - also jene Bohemiens, die genug Zeit hatten, denn die Flanerie bedarf der Muße.
Entscheidend ist zudem, ein sich wandelndes Zeitverständnis am Beginn der Moderne. Im Flanieren stellte der dandyhafte Flaneur zugleich zur Schau, dass es ihm nicht an Zeit mangelte. Dadurch hob er sich von allen anderen Klassen ab, die ihre Zeit vielmehr durch den Arbeitsalltag einzuteilen hatten. Wie sich der Arbeitsethos des Bürgertums bedingt durch den Einfluss des Calvinismus entwickelte, legt Sylvia Stöbe detailliert dar, worauf hier aber nicht näher eingegangen werden soll. Wichtig wäre indes zu betonen, dass daraus sowie aus der tayloristisch ausgenutzten Produktionszeit der Maschinen im Laufe der Industrialisierung weiterhin eine scharfe Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit resultierte. Eine strikte Zeitökonomie war ebenfalls die Folge, die sich zudem auf das private Zeitempfinden auswirkte. Dieser geschichtliche Hintergrund ist überdies für unser heutiges Zeitempfinden - jetzt mehr als einhundert Jahre später - noch relevant. Um erneut Walter Benjamin zu zitieren, so merkte dieser bereits 1929 an, dass die moderne Welt aus dem Flaneur einen »Mann der Menge« gemacht habe, da die Moderne eine allgemeine Hetze in die Stadt gebracht hätte. Zu Recht erkennt Sylvia Stöbe daher unsere heutige, wie sie meint »anachronistische Sehnsucht nach dem Flaneur«. Somit ist der Flaneur zu einer Wunschvorstellung der Moderne geworden.
Der Bilderfluss
Um ein räumliches Erleben der Bilder im [Stadt]-Raum - vergleichbar dem Müßiggang des Flaneurs und seines Stadtspaziergangs - geht es den Gestaltern der Bauhausmaschine. Sie wollen ihre maschinelle Bildprojektion als eine Form von Architektur oder zumindest im Zusammenspiel mit der Architektur verstanden wissen. Denn ebenso wie eine gotische Kathedrale zur Kontemplation einlädt, sich aber nicht aufdrängt, würden auch die Bilder der Bauhausmaschine den Betrachter in Ruhe lassen, meint Stefan Kraus. Wie bereits eingangs erwähnt, erkannte Walter Benjamin die Wirkung neuer Technik auf die menschliche Sinneswahrnehmung. Wiederum ähnlich dem Flaneur, der alles aufzunehmen scheint, was um ihn herum so passiert und es wahrnimmt um des Wahrnehmens Willen, ohne am Geschehen wirklich teilzuhaben oder gar einzugreifen, so verpasst auch das Publikum der Bauhausmaschinen-Bilderfluss rein gar nichts: Die Bilder kommen und gehen und wiederholen sich gegebenenfalls. Anfang und Ende sind jeweils durch das Kommen und Gehen der Zuschauer selbst bestimmt und können daher durchaus unterschiedlich sein.
Die Aura
Das Betrachten der Bilder kommt einem kontemplativen und quasi archaischen Erlebnis gleich, wie dem entrückten Blick in die lodernde Glut des Feuers. Hier schließt sich der Kreis, denn mittels einer hochtechnischen, zeitgemäßen Maschinerie werden Bilder erzeugt, die uralte Träume und Wünsche nach Ruhe und Kontemplation zu erfüllen scheinen. Die Bauhausmaschine mit ihrem projizierten und maschinell reproduzierten Bildmaterial inszeniert also eine neue auratische Erfahrung - so ließe sich schlussfolgern, die Bauhausmaschine sei in der Lage, dem reproduzierten Kunstwerk die gemäß Benjamin verlorene Aura zurückzugeben, vielmehr wird die Bauhausmaschine jedoch mittels ihrer neu komponierten Bilder selbst zur Aufführung eines Kunstwerks und verfügt daher wiederum über eine ihr selbst eigene Aura.
(1) Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt a. M. 1968, Sonderausgabe 1996, S. 13. (2) Ebd., S. 18.(3) Ebd. S. 21. (4) Ebd. (5) Ebd. S. 38. (6) Vortrag von Sylvia Stöbe zur Erlangung der venia legendi an der Universität Kassel am 7.12.1998
Erschienen
in: Sauter & Kraus: BAUHAUSMASCHINE, hrsg. vom Bauhaus.TransferzentrumDESIGN, Weimar 2009, S. 10-19
Bilder:
01 Sauter & Kraus: BAUHAUSMASCHINE (Cover), Gestaltung: Stefan Kraus
02 Die Bauhausmaschine auf dem Thüringer Sommerfest am 26. Juni 2009 in Berlin, Foto: Ricarda Porzelt
|
|


|
|
| |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
| |
bauhaus feminin - Ein Mythos
von Elke Beilfuß
Ich tanze auf allen Wegen.
In alle dunklen Straßen will ich mich stürzen.
Auf der eigenen Spur.
Ich grüße alle Menschen, in allen Häusern,
hinter den Fenstern, in allen Stuben.
Auf der eigenen Spur.
Lyrik von Marianne Brandt (1)
»Die neue Frau ist da - sie existiert« schreibt 1918 die russische Schriftstellerin Alexandra Kollontai. Das Bild der Frauen in den Medien der 1920er Jahre bestimmen selbstbewusste, dynamische, experimentierfreudige Frauen: Die Autofahrerin, die Pilotin, die Sportlerin, die Lebenslustige und der Typ der androgynen Garçonne mit kurzem Haarschnitt und Hosen tragend. Sie alle prägen das Image der Neuen Frau und Zeitschriften wie »die neue linie« verbreiten es. Dies medial vermittelte Bild der Frau in den zwanziger Jahren stellt jedoch einen Mythos dar, der vor allem die Oberfläche und das Äußerliche meint.
Anni Albers, Ré Soupault, Lotte Stam-Beese, Lucia Moholy-Nagy und viele andere standen an der Seite bekannter Männer. Das Interesse an den Frauen, die am Bauhaus studierten und arbei-
teten, richtet sich häufig auf ihren persönlichen Lebensweg sowie ihre Liebes- und Paarbeziehungen mit berühmten Männern aus Künstlerkreisen. Ihre eigenen schöpferischen Leistungen in der Moderne geraten dadurch in den Hintergrund. Andere wie Marianne Brandt, Grete Reichardt, Gunta Stölzl und Benita Koch-Otte gingen einen eigenständigen Weg. Einen leichten Start hatten jedoch alle Bauhäuslerinnen nicht. Die geringere Einschätzung weiblicher Leistungen auch seitens der Bauhausmeister sowie die oftmals fehlende Unterstützung in den Werkstätten bis zur Entscheidung der Leitung, Frauen nur noch in der Weberei aufzunehmen, bzw. in Ausnahmen auch in der Buchbinderei und der Töpferei, erschwerten ihre Ausbildung erheblich. Der Vorschlag wurde laut Meisterrats-
protokoll in der Sitzung am 17. März 1921 angenommen. Sämtliche Meister waren anwesend.
Frauen kamen anfangs zahlreich an das Bauhaus, annähernd zu gleichen Teilen wie Männer. Gropius im Programm von 1919: »Aufgenommen wird jede unbescholtene Person ohne Rücksicht
auf Alter und Geschlecht, deren Vorbildung vom Meisterrat des Bauhauses als ausreichend erachtet wird.« Als aber am
20. September 1920 das Aufnahmeverfahren diskutiert wurde, drängte Walter Gropius auf eine »scharfe Aussonderung gleich bei den Aufnahmen [...], vor allem bei dem der Zahl nach zu stark vertretenen weiblichen Geschlecht.«
»Wo Wolle ist, ist auch ein Weib, das webt,
und sei es nur zum Zeitvertreib«
Sprichwort am Bauhaus (2)
Die Einrichtung einer speziellen Klasse für Frauen ging auf die Initiative von Gunta Stölzl und einiger ihrer Mitschülerinnen zurück, da sie mit dem traditionellen Handarbeitsunterricht der Werk-
meisterin Helene Börner in der Weberei unzufrieden waren. Als Helene Börner nicht mit an das Dessauer Bauhaus zog, übernahm Gunta Stölzl, die Weberei und wurde 1927 zur Jungmeisterin berufen. Stölzl unterstützte selbst als Frau in einem Aufsatz im Bauhaus-Heft 7/1926 das verbreitete Klischee, dass insbesondere die Weberei passende gestalterische Aufgaben für Frauen bot: »Die Weberei ist vor allem das Arbeitsgebiet der Frau. Das Spiel mit Form und Farbe, gesteigertes Materialempfinden, starke Einfühlungs- und Anpassungsfähigkeiten, ein mehr rhythmisches als logisches Denken sind allgemeine Anlagen des weiblichen Charakters, der besonders befähigt ist, auf dem textilen Gebiet Schöpferisches zu leisten.«
Gerade weil am beginnenden zwanzigsten Jahrhundert der Typus Neue Frau steht und zeitgleich mit dem Bauhaus 1919 eine neue Gestaltungsausbildung auflebt, ist rückblickend die Erwartung groß, dass das Bauhaus auf allen Ebenen, auch in Bezug auf die Geschlechterrollen modern war - aber das bleibt ein Mythos.
Marianne Brandt und Gunta Stölzl - zwei Lebenswege
Die wohl bekannteste Schülerin des Bauhauses ist Marianne Brandt, 1893 als Marianne Liebe in Chemnitz geboren. Ihre Entwürfe aus der Metallwerkstatt zählen zu den Objekten, die für das Bauhaus stehen. Weniger bekannt sind ihre Gedichte, sie lagern bisher wenig
beachtet im Bauhaus-Archiv in Berlin. Voller Aufbruchsstimmung, sehr poetisch lyrisch ist das hier wiedergegeben Gedicht. Es inspirierte 2007 auch die Designerinnen Sylvia Steinhäuser und Franziska Ptak zu einer zeitgenössischen Videoarbeit (3), die sie mit Musik vertonten (Komposition: Marlen Pelny). In ihrer Arbeit zeigt sich, wie gut sich die Zeilen als Songtext eignen und wie stark die Sehnsucht nach dem eigenen Lebensweg darin zum Ausdruck kommt. Die Suche nach der eigenen Identität setzte sich bei Marianne Brandt auch mittels der Fotografie - insbesondere des Selbstporträts - fort. In der Weimarer Zeit fotografierte sie sich sehr feminin mit Blütenmotiv (4). Später am Bauhaus experi-
mentierte sie in ihren Selbstbildnissen mit ihrem Material Metall: Sie spiegelt sich in glänzenden Kugeln oder porträtiert sich in selbst-
bewusster Pose mit einem zum »Metallischen Fest« eigens entworfenen Kopfschmuck.
Zunächst studierte Marianne Brandt Malerei in Chemnitz und in München. Privat verband sie damals die Kunst und die Liebe mit dem norwegischen Maler Erik Brandt, den sie 1919 heiratet und mit ihm bis 1921 im Ausland, teils in Norwegen, teils in Südfrankreich lebte. Dann kehrte das Paar nach Deutschland zurück und kam nach Weimar, hier setzte Marianne Brandt anfangs ihr Studium der Malerei fort. Im Januar 1924 wurde sie Schülerin am Staatlichen Bauhaus und wechselte mit nach Dessau. Bei Josef Albers und Laslo Moholy-Nagy wurde sie in der Werk- und Materiallehre ausgebildet, in der künstlerischen Gestaltung von Wassily Kandinsky und Paul Klee. In der Metallwerkstatt wurde sie zum Silberschmied ausge-
bildet. Sie blieb bis 1929 am Bauhaus, leitete zwischenzeitlich die Metallwerkstatt und schloss ihr Studium mit dem Diplom ab. Für eine kurze Zeit entwarf sie 1929 Möbel- und Inneneinrichtung am Berliner Atelier von Walter Gropius. Anschließend nahm sie in Gotha eine Anstellung als Leiterin der Entwurfsabteilung in der
Metallwarenfabrik Ruppelwerke an, wo sie bis 1932 blieb. Danach wurde es still um sie. Sie beschäftigte sich mit Malerei. Privat verlor sie in dieser Zeit beide Eltern und ließ sich von Erik Brandt scheiden, von dem sie sich aber schon seit einiger Zeit getrennt hatte. Erst 1949 übernahm sie wieder Tätigkeiten an Gestaltungs-
hochschulen in Dresden und Berlin-Weißensee in der DDR. 1954 kehrte sie in ihre Heimatstadt Chemnitz [damals Karl-Marx-Stadt] zurück und widmete sich wieder ganz der bildenden Kunst, der Malerei und Plastik. Im hohen Alter von 90 Jahren starb Marianne Brandt 1983.
das lose Gespinst, das nur durch die
Ordnung, der man es unterwirft, zur
bestimmten Fläche sich bindet;
eine Mannigfaltigkeit von
Verkreuzungen, die zu einer Oberflächenplastik führen;
die Farbe, gesteigert oder geschwächt
durch Glanz oder Stumpfheit;
das Material, dessen Eigenschaften uns
Grenzen in seiner Verarbeitung setzen.
Gunta Stölzl (5)
Gunta Stölzl war die einzige Bauhausschülerin, die später Meisterin am Bauhaus wurde, wovon ihr handschriftlich geänderter Studentenausweis zeugt (6). 1897 wurde sie als Gunta Stölzl in München geboren. Unter ihrem Mädchennamen ist sie bis heute bekannt, obwohl sie jeweils die Namen ihre Männer, 1927 in der ersten Ehe (Sharon) und 1942 in der zweiten Ehe (Stadler), annahm. Immerhin blieb ihr Anfangsbuchstabe immer das S. In ihren späteren Firmengründungen mit Kompagnons in der Schweiz war der für sie stehende Buchstabe das S. Die Firmennamen waren S-P-H-Stoffe und später S+H-Stoffe und zuletzt stand für ihre alleinige Firma dann Sh-Stoffe (Sharon & Co.).
Bevor Gunta Stölzl als eine der ersten Studenten 1919 an das Bauhaus kam, hatte sie bereits an einer Kunstgewerbeschule studiert. Während des ersten Weltkriegs meldete sie sich als freiwillige Rotkreuzschwester und arbeitete im Lazarett. 1919 wechselte sie von der Kunstgewerbeschule in München an das Bauhaus nach Weimar, wo sie 1920 in die Klasse für Weberei aufgenommen wurde. Sie legte ihre Gesellenprüfung in der Weberei
bereits 1922/1923 ab. Ab 1925 war sie Werkmeisterin der Weberei und von 1927 bis zum September 1931 Meisterin der Weberei und hatte damit die Leitung der Werkstatt von Georg Muche über-
nommen. Sie verließ 1931 das Bauhaus und ging in die Schweiz. Dort gründete sie gemeinsam mit den ehemaligen Bauhäuslern Gertrud Preiswerk und Heinrich-Otto Hürlimann die Handweberei S-P-H-Stoffe in Zürich. Wenige Jahre darauf (1935) führte sie gemeinsam mit Heinrich-Otto Hürlimann die Firma S+H-Stoffe, die sie dann ab 1937 mit dem Namen Sh-Stoffe dreißig Jahre lang alleine weiterführte. Die Firma stellte bis 1967 Möbelstoffe und Teppiche her. Das Schaffen von Gunta Stölzl wurde 1976 mit einer Einzelausstellung im Bauhaus-Archiv in Berlin gewürdigt. Gunta Stölzl starb 1983, im selben Jahr wie Marianne Brandt.
(1+3) in: Sylvia Steinhäuser und Franziska Ptak: Wer weiß, ich nicht. Videocollage, 2007 www.funkplatz.de (2) Oskar Schlemmer wird nachgesagt, er habe diesen Spottvers am Bauhaus geprägt. (4) Marianne Brandt: Selbstporträt mit Chrysanthemen (um 1920), Bauhaus-Archiv Berlin. (5) Gunta Stölzl: Weberei am Bauhaus, in: Bauhaus-Heft, 7/1926. (6) Ausweis von Gunta Stölzl am Bauhaus Dessau (1928), Bauhaus-Archiv Berlin.
Erschienen
Kulturjournal Mittelthüringen, Heft April 2009, S. 11.
Bilder:
01 - 02
Sylvia Steinhäuser und Franziska Ptak
»Wer weiß, ich nicht« 2007, Videostills |
|

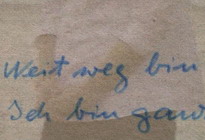
|
|
| |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
| |
Ästhetik & Alltagserfahrung
VII. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik
von Martina Sauer und Elke Beilfuß
Bericht aus Forschung und Lehre
Ästhetik und Alltagserfahrung, VII. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik, 29. September bis 2. Oktober 2008, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Ernst Abbe-Platz
»Mit welchen Methoden lässt sich die ästhetische Erfahrung zum Alltag öffnen, ohne dabei den Alltag als große Kunst zu werten?« Mit dieser Frage eröffnete der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik Lambert Wiesing (Jena) den 7. Kongress der Gesell-
schaft in Jena. In 58 Referaten wurde hier vier Tage lang vom 29.09. bis 02.10.2008 zum Thema Ästhetik und Alltagserfahrung diskutiert. Neben der Natur- und Kunsterfahrung könne, so Wiesing, die Einbeziehung der Alltagserfahrung die Weite ästhetischer Empfindungen deutlich machen und zugleich zu deren Binnen-
differenzierung beitragen. Hintergrund und zugleich Anlass für rege Diskussionen lieferte die immer noch Maßstäbe setzende Aussage Kants, wonach sich ästhetische Erfahrung durch interessenloses Wohlgefallen auszeichne, während im Alltag Funktionalität und Nützlichkeit bzw. lebensweltliches Interesse dominiere. Dass dem entgegen heute die Grenzen zwischen beiden Erfahrungswelten verwischen und entsprechend eine Annäherung erkennbar wird, machten zahlreiche Beiträge deutlich. Erfrischend wirkte auf dieser Tagung, dass neben etablierten Lehrstuhlvertretern aus dem breiten Kanon der kulturwissenschaftlichen Fächer einschließlich der Soziologie viele Vertreter aus dem Mittelbau und insbesondere Frauen als Referentinnen eingeladen wurden. Die Tagungs-
organisation sorgte Dank großzügiger Unterstützung und Förderung durch die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Fritz Thyssen Stiftung und die Firma Reisenthel für den entsprechenden Rahmen.
Was unterscheidet die ästhetische Erfahrung eines Kunstwerks von derjenigen, die unseren Alltag ausmacht, sei es von Erfahrungen mit einem Ding, einem Designobjekt, einem Foto oder Film? Grundlegend zeigte sich, dass insbesondere die Qualität der ästhetischen Erfahrung eine andere ist. Statt einem Verstehen arbeite die ästhetische Erfahrung im Alltag insbesondere dem Genuss zu und gebe dem Leben derart einen »Schimmer« bzw. »eine Ahnung weniger Momente geglückten Lebens«, so Konrad Paul Liessmann (Wien) in seinem Eröffnungsvortrag. Dass diese Erfahrung im Alltag auch zur Überwindung der Existenzangst
beiträgt, in dem eine Übereinstimmung von Ich und Welt eröffnet werde, zeigte Josef Früchtl (Amsterdam) am Beispiel des Films. Geleistet werde dies durch das Vertrauen, das die Zuschauer den Akteuren, seien es Brad Pitt oder George Clooney, schenken. Es ermögliche eine Erfahrung des als ob eine Beziehung zwischen Ich und Welt bestehe. Wie sehr auch die Mode dem als ob gerecht wird, zeigte Petra Leutner (Hamburg). Wobei deren affektive Kraft eine sakrale Aufladung der Mode erlaube. Sie kann, nach Leutner, als die Grundlage für eine pathologische Sucht nach permanentem Konsum angesehen werden. Das Spiel der Mode, das ursprünglich ein interessenloses Wohlgefallen ermögliche, wird durch die von der Ökonomiesierung betriebenen Intensivierungstechniken zum must have erhöht. Statt einer Entlastung von Wahrheit und Moral finde eine Belastung statt und das Ich reduziere sich auf Wünsche. Dass Mode von Moderedakteuren irritierend inszeniert auch die Möglichkeit bietet, dem must have zu entgehen und statt dessen dem eigenen Begehren zu begegnen und damit Freiräume schaffen kann, zeigte Dagmar Venohr (Potsdam).
Als eine besondere Leistung der ästhetischen Erfahrung könne es angesehen werden, dass durch sie das Gewöhnliche des Alltags durchbrochen werden kann, wie Mirjam Schaub (Berlin) am Beispiel des Horrors im Film und romantischen Komödie verdeutlichte. Beiden Genre gelänge es, die Unerträglichkeit des Gewöhnlichen (Stanley Cavell) zu durchbrechen, in dem sie den individuellen Schutzraum jedes Einzelnen durchstoßen, so dass das Vertraute
unheimlich wird. Hierdurch entstehe eine Distanz, die die im Alltag als unerträglich empfundene Nähe (des Gewöhnlichen) kompensiert.
Insofern beide sowohl die Kunst als auch der Alltag ästhetische Erfahrungen ermöglichen, wie kommt es dann zu deren Differenzierung, hängt das im Wesentlichen nur von der
ästhetischen Einstellung ab? Werden Objekte erst dann kunst-
würdig, wenn sie von einem Fachvertreter als solche herausgestellt werden? Die Analyse von Gottfried Gabriel (Jena) zur politischen Ikonografie von Briefmarken legte dies indirekt nahe. Bernadette Collenberg-Plotnikov (Hagen) schloss sich dem an, indem sie herausstellte, dass Objekte erst dann Kunststatus erhalten, wenn sie von Mitgliedern der Kunstwelt ausgestellt und musealisiert werden. Doch hat nicht das Designobjekt als solches bereits Kunstwürdigkeit, weil es durch seine form- und damit handlungs-
bestimmende Kraft ebenso welterschließend wirken kann, wie Kathrin Busch (Lüneburg) verdeutlichte?
Bei genauer Betrachtung scheinen tatsächlich die distanz-
schaffenden Momente einer musealen Präsentation nötig, um eine Trennung etwa von Kunst und Design zu vollziehen. Denn nur ansatzweise, so lassen die Beiträge deutlich werden, können ästhetische Erfahrungen gegen Alltagsbestimmungen wie Nützlichkeit, Funktionalität und lebensweltliches Interesse angehen und tragen dem entgegen letztlich eher zu deren Verschleierung bei. Constanze Peres (Dresden) betonte entsprechend die Unruhe stiftende, Diskrepanzen erzeugende Kraft der ästhetischen Erfahrung von Kunst. Sie löse entgegen der Harmonie, die die Schönheit von Alltagsgegenständen bestimme, ein Immer-wieder-Sehenwollen aus. Sehr deutlich stellten sich Wolfgang Ullrich (Karlsruhe) und Ludger Schwarte (Basel, demnächst Zürich) dazu. Die zu beobachtende Ästhetisierung der Alltagswelt fördere eher eine Entfremdung von Ich und Welt. So sprach ersterer von »Doping durch Design« bzw. »Placebo-Effekten von Produkten«. Entsprechend mag sich der Radfahrer durch seinen Fahrradhelm schneller fühlen und die Studentin nach morgendlichem Gebrauch ihres Sport-Active-Showergels tatsächlich aktiver, doch der Alltag werde damit negiert und romantisiert. Ludger Schwarte schloss sich indirekt dieser Beobachtung an und wertete die Entwicklung als
»Konsum der Entfremdung«. Ästhetik übernehme hier eine gesellschaftliche Funktion, in der Fest und Alltag unterschiedslos sind und das Leben insofern von einer Ereignisreihe bestimmt wird. Im alltäglichen »Bloß-Fühlen«, für das Kant mit seiner Definition der ästhetischen Erfahrung die Grundlage gelegt habe, werde Lebens-
zeit konsumiert und als Freiheit verkauft. Doch Handeln und Denken als wahrhaftig ästhetische Rationalität liegt nach Schwarte in Anlehnung an Adorno im »Sinn des Unmöglichen«, wonach »im Leben wieder etwas riskiert werden muss.«.
Da Ludger Schwarte von den Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik am zweiten Abend zum neuen Präsidenten gewählt und Lambert Wiesing sowie Birgit Recki (Hamburg) als Vizepräsidenten bestätigt wurden, lässt dieser Ansatz zukünftig auf lebhafte Diskussionen nicht nur zu Kant, sondern entgegen der auf der Tagung größtenteils vollzogenen Annäherung von Kunst und Alltag schließen. In dem Fokus auf »Experimentelle Ästhetik«, die das Thema der nächsten Tagung in Zürich sein soll, wie Schwarte zum Abschluss des Kongresses in Jena ankündigte, klingt dieser Impuls bereits an.
Erschienen
»Tagungsbericht: Ästhetik und Alltagserfahrung«
VII. Kongress der Deutschen Gesellschaft
für Ästhetik, gemeinsam mit Martina Sauer, in: h-soz-kult, Tagungsberichte, veröffentlicht am 18.11.2008 |
|
|
|
| |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
| |
Inszenierung in der Inszenierung
Eindrücke in der Installation »Public Freedom« von
Carol Christian Poell im CAT (Contemporary Art Tower) Wien
von Elke Beilfuß
An einem heißen Septembertag blies auf dem Gang des ehemaligen
Gefechtsturms Arenbergpark ein kühler, geradezu eisiger Wind. Gemeinsam mit der Kuratorin Heidemarie Caltik und einem
Wiener Designstudenten warte ich darauf, die Installation »Public
Freedom« im einstigen Munitionsraum zu betreten. Wir warten, da
aus Gründen der Sicherheit jeweils nur eine Gruppe die Installation
betreten darf. Kalte, klirrende Geräusche, das Kreischen jugendlicher Besucher gemischt mit Hundegebell dringt zu uns auf den Gang. Was erwartet mich - eine Geisterbahnfahrt?
Es dauert bis etwas geschieht. Gesteuert durch die Bewegung der
Besuchergruppe startet eine Videoprojektion über raue Betonwände und einen Treppenaufgang. Der Raum wirkt finster. Das Auge gewöhnt sich langsam an die Dunkelheit. Zu sehen sind
Menschen hinter Gittern. Die Projektionsfläche des unebenen
Betons verschmilzt geradezu mit der Kulisse. Kein herunterge-
kommenes Gefängnis, in das einzelne Menschen hier gesperrt wurden, es sind Hundezwinger im Mailänder Tierasyl. Das Gebell der Tiere ist zu hören. In der Wahrnehmung verschränken sich die Ebenen: die Oberflächen des ehemalige Munitionsraumes, die Geräusche, die Menschen und die Kleidung. Es dauert eine gewisse Zeit, bis ich beginne auf Details zu achten, denn hier ist eine Modepräsentation auf den Schauen in Mailand dokumentiert. Die Herrenkollektion »Public Freedom« (Herbst Winter 2001/02) des Designers Carol Christian Poell wird einem Fachpublikum vorgestellt. Im Filmbild setzt sich die Vermischung der Ebenen fort.
Die Materialien der Kleidung sind kaum isoliert zu betrachten, überhaupt ist es schwer, sie exakt zu erkennen. Aus genau diesem
Grund mag ein Blow-up als Motiv für die Einladungskarte ausgewählt sein: Eine behandschuhte Hand umfasst das Gitter. Der
Handschuh ist in seiner Farbigkeit dabei den abgeplatzten, rosa-rostigen Stellen der Gitterstäbe ähnlich. Im Gegensatz zu den offenen Roststellen gleicht der Handschuh jedoch einer Schutzhaut.
Das hautähnliche Material aus transparenter Tierhaut (1) unter-
streicht diesen Charakter.
In Abwesenheit des momentanen Ereignisses, gelingt es Carol
Christian Poell in seiner Wiener Installation einen erneuten, von der
ursprünglichen Situation verschiedenen authentischen Moment zu
gestalten, indem er die Inszenierung abermals in Szene setzt. Die
bereits beschriebene Verschränkung des Dokumentationsmaterials
mit der Situation und insbesondere mit den Oberflächen des Raumes ist Teil der Inszenierung. Die im Video konservierte
Zeit ist zudem auf die Zeit der Besucher abgestimmt. Durch
Kopplung und Interaktion mit der Besuchergruppe, beginnt die
Präsentation, sobald ich - sobald wir - in der Gruppe gemeinsam
den Raum betreten und durchschreiten. So endet das Video, wenn
wir uns auf die Treppe nach oben begeben und die nächste
Präsentation beginnt im darüber liegenden Geschoss.
Nach dem Eingesperrtsein darf jetzt geflüchtet werden. Wieder
wird Herrenmode vorgeführt - diesmal unter dem Motto
»Traditional Escape« (Frühling/Sommer 2002). Das erste männliche
Model erscheint auf einem Balkon, dann beginnt er einige weiße
Laken zusammenzubinden, sie herunterzulassen und dann selbst
die Flucht anzutreten - tatsächlich eine traditionelle Flucht. Einer
nach dem anderen klettert nach ihm vom Balkon und durchquert
die Zuschauermenge. Bei der Aktion tragen alle Männer eine
Augenbinde, als seien sie zum Tode verurteilt. Ich frage mich, ob
sie wohl soeben dem Schafott entkommen konnten. Die Oberflächen gehen auch hier eine Symbiose ein: Die Wandfläche,
an der die Männer sich herablassen, verbindet sich optisch wiederum mit der Betonwand im Flakturm. Gerade diese Verbindung von Architektur und Werk sucht auch das Konzept des CAT (Contemporary Art Tower) von Peter Noever zu realisieren.
Arbeiten von Designern und Künstlern, die spezifisch auf den Ort
reagieren und ihn neu bestimmen. Das Raumangebot im Flakturm
aus der Nazizeit ist immens, so dass ausreichend Platz für gestalterische Interventionen zur Verfügung steht. Bisher fehlen noch die Gelder für die Umsetzung des ehrgeizigen Projekts. Daher flackert die Idee punktuell auf. So auch in der Inszenierung von Poell im CAT, selbst wenn seine Videos gar nicht für den Kontext Kunst entstanden.
Es versteht sich, dass die Entwürfe von Carol Christian Poell ebenso
unkonventionell sind wie seine Inszenierungen. Er spielt mit den
Konventionen: Der rechte Schuh sitzt am linken Fuß und der linke
am rechten - Ziegenfüße sagten die Erwachsenen zu uns Kindern, wenn wir unsere Schuhe versehentlich oder absichtlich so anzogen. Die Hosen wirken zu lang geschnitten. Ein Strickpulli mit einen Loch am Rollkragen, dort wo der Kehlkopf sitzt, wird mal mit und mal ohne Krawatte vorgeführt. Die Materialien sind ungewöhnlich, Poell verwendet transparente Tierhaut für Handschuhe oder lässt aus Gedärmen Pullover stricken. Ein Material, das mich an die histo-
rische Variante des Kondoms denken lässt; bevor Kunststoffe entwickelt waren, wurden Kondome aus Tierdarm genäht. Die Konvention aber auch die Sexualität thematisiert Poell in seinen Entwürfen, wenn er beispielsweise die Hosen der Männer im Schritt offen lässt. Auch die voluminösen Krawatten können als ein Verweis auf den männlichen Sexus verstanden werden.
Geht man weiter in Richtung einer zweiten Treppe, die wieder in
den unteren Raum und zum Ausgang führt, beginnt hier die letzte
Vorführung. In »Mainstream - Downstream« (Male Frühling /
Sommer 2004) treiben erst einzelne Kleidungstücke, dann voll
bekleidete Menschen, völlig regungslos wie Wasserleichen, auf
einem Fluss vorbei. Sie sind schauerlich schön anzusehen. Eine
Modeschau, die Poell inszeniert wie eine Katastrophe. Damit bringt
er seine Ansicht zum Ausdruck, dass Mode immer mehr in nur eine
Richtung (Mainstream) treibt und dann droht den Bach runter zu
gehen (Downstream).
Ich frage mich, was sich in diesem Szenario wohl ereignet haben
mag. Weit erschreckender aber muss der unmittelbare Eindruck
dieser Performance - in natura - gewirkt haben. So wie wir an Bilder von Katastrophen in Film und Fernsehen gewöhnt sind, sie durch das Medium gleichsam gefiltert wahrnehmen und notfalls umschalten können, so ist das unmittelbare Erfahren einer tragischen Situation jedoch um ein vielfaches dramatischer. Katastrophen sind nicht erst seit September Eleven Medien-
ereignisse, der Vergleich zu Kunstformen wurde jedoch nach dem Attentat auf das World Trade Center geäußert (2) und kontrovers diskutiert.
Heidemarie Caltik, die Kuratorin der Ausstellung im CAT, erlebte
die Modeperformance »Mainstream - Downstream« im Juni 2003
Mailand. Den Moment des Erstaunens, als sie die Menschen vorbei
schwimmen sah, schilderte sie als ein ästhetisches Empfinden.
Die gesamte Aufmerksamkeit sei so gezielt auf die optische
Wahrnehmung des Geschehens gerichtet, denn der visuelle Ein-
druck sei so stark gewesen, dass alle übrigen Sinne gleichsam
abgeschaltet waren, so dass sie ganz bei sich selbst und mit sich
selbst und ihrem Innersten gewesen sei. Eine Erfahrung, wie sie im
Leben nur in Ausnahmezuständen gemacht wird, die Heidemarie
Caltik insbesondere der Kunst zuschreibt. (3)
(1) Leder, das durch ein spezielles Verfahren transparent wird. (2) In der Pressekonferenz zum 2. Hamburger Musikfest (am 16.9.2001) bezeichnete der Komponist Karlheinz Stockhausen den Anschlag vom 11. September 2001 als »das größte Kunstwerk, das es je gegeben hat«, vgl. Jens Jessen: Kunst fatal. Karlheinz Stockhausens Äußerungen zum New Yorker Anschlag sind nicht nur abscheulich, sondern auch höchst aufschlussreich, in: Die Zeit, Nr. 39, 2001. Zum Thema siehe auch: Luca Di Blasi: Die besten Videos drehte al-Qaida. Zwei Jahre nach den New Yorker Anschlägen: Zwischen Kunst und Terrorismus gibt es eine tiefe Wahlverwandtschaft, in: Die Zeit, Nr. 34, 2003. (3) Heidemarie Caltik am 1. September 2005 beim Besuch der Ausstellung im Gespräch mit der Verfasserin.
Bilder:
01 - 02 Carol Christian Poell »Public Freedom« 2001
03 Ausstellungsansicht »Public Freedom«
04 Carol Christian Poell »Traditonal Escape« 2002
05 - 06 Carol Christian Poell »Mainstream - Downstream« 2003
Fotos 01, 02, 04, 05, 06 von Stefan Zeisler
Foto 03 von Georg Mayer/MAK |
|






|
|
| |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
| |
Ausstellung gestalten
Das Haus Am Horn als musealer Präsentationsraum
von Elke Beilfuß
»Es gibt kein Vergangenes, das man zurücksehnen dürfte, es gibt nur ein ewig Neues, das sich aus den erweiterten Elementen des Vergangenen gestaltet, und die echte Sehnsucht muß stets produktiv sein, ein neues, besseres Erschaffen.« J.W. von Goethe
»Tradition oder Neuheit?« (1) betitelte Horst Michel einen Aufsatz, in dem er diese Frage hinsichtlich der Gestaltung und Herstellung von Gebrauchsgerät um 1956 in der DDR thematisierte. Jenes Goethezitat hat er eben diesem Artikel vorangestellt. Die Ausstellung über den Formgestalter Horst Michel und das Institut für Innengestaltung ist in diesem Sinne nicht mit (n)ostalgischen Momenten konzipiert. Allerdings treffen in der Ausstellung im Haus Am Horn zwei designgeschichtlich unterschiedliche Zeiten aufeinander: Die Tradition des Bauhauses und das Design der DDR. In diesem Beitrag geht es daher primär um die Frage, ob ein architekturhistorisches Ensemble, das gewissermaßen selbst ein Exponat darstellt, als Ausstellungsgebäude für Gestaltung dienen kann und wie sich an diesem Ort Tradition mit Aktualität begegnen.
Die Räumlichkeiten im Haus Am Horn bieten per se keinen musealen Präsentationsort im Sinne eines »White Cube« (2).
Der weiße Kubus bildet idealtypisch einen neutralen Ausstellungsraum, in ihm sind die Exponate aus ihrem ursprünglichen, zumeist alltäglichen Zusammenhang gelöst. Zudem werden sie in der Präsentation auf einen Sockel gestellt. Im musealen Kontext erfahren die Objekte damit gleichsam eine Weihe, sie werden geheiligt und folglich musealisiert.
Das Haus Am Horn, 1923 von Gerhard Muche entworfen, wurde ursprünglich als Versuchsbau vorgestellt. Das Wohngebäude im Stil der neuen Sachlichkeit entstand in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro von Walter Gropius. Für die Präsentation des Musterhauses gestalteten Bauhäusler die Innenräume. Lehrer und Schüler richteten die Zimmer mit Möbeln ein bzw. entwarfen eigens Ausstattung, Einbauten und Leuchten; die Ausmalung konzipierten Bauhausschüler aus der Werkstatt der Wandmalerei. Nach langjähriger Nutzung als Wohnhaus mit entscheidenden An- und Umbauten bereits ein Jahr nach Fertigstellung wurde das Objekt zum Kulturstadtjahr 1999 rückgebaut, saniert und als Denkmal in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. (3) Seither dient es als Ausstellungshaus für die Präsentation von Kunst und Design. Allerdings wird es von Interessierten häufig nicht wegen der temporären Ausstellungen, sondern um seiner selbst willen als historisches Gebäude des Weimarer Bauhauses besucht. Dieser Erwartung wird beispielsweise ein speziell ausgearbeitetes Audio-Video-Guidesystem zur Architektur gerecht, das derzeit [2004
Anm. EB] im Haus Am Horn getestet wird. Der Besucher erhält über ein neuartiges mobiles System per Kopfhörer und Display Informationen zu den einzelnen Räumen, in denen er sich gerade befindet.
Eine entscheidende Besonderheit des Haus Am Horn sind die farbig ausgestatteten Innenräume. Die Wände sind in blassen Farben gehalten, von Hellgelb und Lindgrün bis Hellgrau. Einige Farbakzente hingegen sind in Rot, Blau und Tiefschwarz gesetzt.
Da die Farbgebung der Räume in wesentlichen Ansätzen denkmal-
pflegerisch rekonstruiert wurde, ist sie Teil des historischen Ensembles. Die Farbigkeit der Wände ist somit festgelegt und gibt insofern jeder Präsentation einen gestalterischen Rahmen vor.
Des Weiteren ist der Grundriss des Einfamilienhauses für eine komplexe Nutzung auf relativ geringer Fläche gegliedert. Die Zimmer sind um einen großzügigen zentralen Wohnraum gruppiert, ihre Funktionen sind definiert und mit minimaler Quadratmeterzahl geplant. So ist das kleinste Zimmer mit acht Quadratmetern gerade groß genug für einen Essplatz. Um den Platz effektiv zu nutzen, wurden zudem Schränke integriert, die überdies als architektonisch gliedernde Elemente zu begreifen sind.
Zusammenfassend formuliert, wirken sich vor allem drei Aspekte grundlegend auf die Ausstellungspraxis im Haus Am Horn aus:
Das Wohngebäude als eigenständiges Exponat, die historische Farbgestaltung der Wände sowie die Kleinheit der Räume.
Aus diesem Sachverhalt ergibt sich die Frage, wie die kuratorische Praxis auf die spezifischen Bedingungen im Haus Am Horn reagieren kann.
Ein Ansatz, der das Gebäude als Exponat würdigt, wäre die konsequente Trennung der Vermittlung von Architekturhistorie und Ausstellung. Mit dem Audio-Guide-System ließe sich dieser Ansatz weiterverfolgen, indem sämtliche Informationen zur Architektur und historischen Innenausstattung des Hauses allein durch das tragbare Gerät übermittelt werden. Das Medium Ausstellung ist hiervon durch die spezifischen Elemente der Präsentation und Vermittlung (Original, Texttafel, Label, Filmdokument) unterschieden.
Erschienen
Auszug. Der Text ist vollständig abgedruckt in: Horst Michel. Formgestalter in Weimar. Die Ausstellung, hrsg. von Siegfried Gronert und Elke Beilfuß, Weimar 2004, S. 71-75.
(1) Horst Michel: »Tradition oder Neuheit«, in: Gelbe Hefte, 1956. (2) Brian O`Doherty: In der weißen Zelle/Inside the White Cube, Wolfgang Kemp (Hrsg.), Berlin 1996. (3) Siehe hierzu: Das Haus »Am Horn«. Denkmal-
pflegerische Sanierung und Zukunft des Weltkulturerbes der UNESCO in Weimar, Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen (Hrsg.), Frankfurt a. M. 1999.
Bilder:
01 - 02 Ausstellung »Horst Michel« 2004, im Haus am Horn |
|

 |
|
| |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|